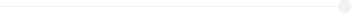Fördermittel-Guide: BGS, QCG, Aufstiegs-BAföG, Bildungsurlaub & Co – was passt wann?
Übersicht der wichtigsten Weiterbildungs-Förderinstrumente neben dem QCG.
veröffentlicht am:
2025-06-15


Fördermittel-Guide: Bildungsgutschein, Aufstiegs-BAföG, Bildungsurlaub & Co – was passt wann?
In mittelständischen Unternehmen gibt es vielfältige Möglichkeiten, Weiterbildungen finanziell fördern zu lassen, doch welche Förderung passt in welcher Situation? Dieser praxisorientierte Guide liefert einen Überblick über die wichtigsten staatlichen Fördermittel für berufliche Weiterbildung und zeigt, für wen sie gedacht sind, was gefördert wird, wo man sie beantragt und worauf man in der Praxis achten sollte. Insbesondere Personalverantwortliche und Geschäftsführer in Berlin, Hamburg und Bayern finden hier hilfreiche Tipps, um ihren Mitarbeitern die passenden Förderprogramme für Weiterbildung zu ermöglichen.
1. Bildungsgutschein (Agentur für Arbeit / Jobcenter)
Ein Bildungsgutschein ist die wohl bekannteste Weiterbildungsförderung der Bundesagentur für Arbeit. Damit übernimmt das Arbeitsamt bis zu 100 % der Weiterbildungskosten. Das sind etwa Kursgebühren, Lehrmaterial, Fahrten, auswärtige Unterbringung und sogar Kinderbetreuung, wenn man mal nicht weiß, wohin mit dem Nachwuchs. Die Förderung richtet sich primär an Arbeitsuchende und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer. Voraussetzung ist, dass die geplante Weiterbildung notwendig ist, um Arbeitslosigkeit zu beenden oder eine drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden. Mit anderen Worten: Ein Bildungsgutschein wird in der Regel dann bewilligt, wenn die Maßnahme die Jobchancen deutlich verbessert – zum Beispiel eine Umschulung in einen gefragten Beruf oder eine gezielte Anpassungsqualifizierung bei veralteten Fähigkeiten. Die Weiterbildung z. B. zum Schamanen fällt nicht darunter.
2. Qualifizierungschancengesetz: Weiterbildung für Beschäftigte
Infografik: Die Qualifizierungsoffensive verbessert die Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten je nach Betriebsgröße (Kleinstbetrieb bis Großunternehmen). Kleine Unternehmen (<50 Mitarbeitende) können bis zu 100 % der Weiterbildungskosten und bis zu 75 % des Lohns während der beruflichen Weiterbildung als Zuschuss erhalten. Bei größeren Unternehmen sinken die Prozentsätze gestaffelt.
Während der Bildungsgutschein vor allem für Arbeitslose gedacht ist, zielt das Qualifizierungschancengesetz (QCG) auf weiterbildende Arbeitnehmer in laufendem Arbeitsverhältnis. Umgangssprachlich spricht man von „Qualifizierungsoffensive“. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können hierbei Förderungen von der Bundesagentur für Arbeit erhalten, um Qualifizierungen im Betrieb zu ermöglichen. Insbesondere bei technologischen, strukturellen, gesellschaftlichen Veränderungen oder Fachkräftemangel können Mitarbeiter so durch betriebliche Weiterbildung im Unternehmen gehalten werden.
3. Aufstiegs-BAföG (ehem. Meister-BAföG)
Wer eine höherqualifizierende Weiterbildung machen möchte, etwa zum Handwerksmeister, Techniker, Fachwirt, Betriebswirt (Bachelor/Master Professional) oder einen vergleichbaren Fortbildungsabschluss, kann vom Aufstiegs-BAföG profitieren. Dieses staatliche Förderprogramm nach dem AFBG unterstützt berufsbegleitende Weiterbildung oder Vollzeit-Fortbildungen finanziell, vergleichbar zum Studenten-BAföG in der beruflichen Bildung.
Bildungsurlaub (Bildungszeit): bezahlte Lernzeit für Beschäftigte
Bildungsurlaub bedeutet: Eine Arbeitnehmerin wird für eine bestimmte Anzahl von Tagen im Jahr von der Arbeit freigestellt, um an einer Weiterbildung teilzunehmen – bei Fortzahlung des Gehalts. Diese Regelung ist jedoch Ländersache, das heißt jedes Bundesland hat eigene Gesetze dafür (oder auch nicht).
Regionale Förderprogramme: Bildungsschecks, Bildungsprämien & Co.
Neben den großen Bundesprogrammen gibt es in einigen Bundesländern zusätzliche Förderprogramme für Weiterbildungen, oft finanziert aus dem ESF und Landesmitteln. Diese Bildungsschecks, Bildungsprämien oder Bildungsboni richten sich meist an bestimmte Zielgruppen wie Geringverdiener, kleine Unternehmen oder bestimmte Branchen.
Steuerliche Absetzbarkeit von Weiterbildungskosten
Auch Zuschüsse der Bundesagentur (z. B. aus dem QCG) sind steuerfrei. In der Regel gilt: Auch sozialversicherungsfrei, sofern betriebliches Interesse vorliegt.
Ihre Ansprechpartnerin
Jennifer Benthin
Unique Akademie
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Telefon: +49 30 887190-12
E-mail: jbenthin@unique-akademie.de

Kontakt